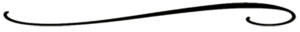Nachruf J. Häupl
von Koller Wilhelm 1984
Eine große, stille Flamme erlosch
Zum Gedenken an Josef Häupl
Zur ersten Kollektivausstellung Josef Häupls im Mai 1960 in der Galerie Kliemstein stand im Einladungsprospekt zu lesen:
„Fromm-gläubiges Dasein wählt nur Dinge und Sujets, die den Wert des Lebens garantieren. Die Bilder malt er an Sonntagen und Feierabenden. Seine Malerei lebt aus frommer Dankbarkeit gegenüber dem Geschick und gläubiger Haltung gegenüber dem Menschen. Darin liegt aber die Gefahr seines künstlerischen Wandels – leicht verkehrt sich die Dankbarkeit gegenüber dem Dasein in passive Lebenshinnahme und die Gläubigkeit an den Menschen in eine Toleranz aus Furcht vor dem Nächsten! Eine Ahnung der negativen Seiten des Gesagten ist aus den Bildern Josef Häupls deutlich spürbar.
Seine Landschaften haben neben einer gewissen paradiesischen Stimmung auch immer etwas von einem Friedhofsflecken an sich. In seinen Stilleben wird das Zurückzucken der Farben voneinander spürbar, was oft der Malerei den Anschein gleichgültiger dekorativer Wirkung eindrückt. Doch man soll sich davon nicht täuschen lassen. Häupl’s zäher Lebenswille weiß die Formen durch eine stark ausgeprägte Kontur, die zugleich Abgrenzung und Verbindung ist, in gehaltvolle Beziehung zu setzen. Das schönste Beispiel hierfür ist das Bild mit dem geschlachteten Huhn. Häupls duldsamer Charakter, der in seinem opfervollen Geschick die wertvollste Kraft darstellt, kommt in dem oben genannten Bild zwingend zum Ausdruck. Die andere Seite aber, die Seite des Lebenstrotzes nämlich, tritt uns oft düster anmutend in seinem Landschaftsbildern entgegen. Zusammengezückt die Bäume, blockhaft, wehrhaft die Häuser, der Boden immer schwingend. Es besteht für den ernsthaften und wohlwollenden Beschauer kein Zweifel darüber, dass trotz jener Seiten an Häupls bisher Geschaffenem, die uns seine Problematik zeigen, Häupl als einer der zukunftsträchtigsten Talente unseres näheren Kulturkreises geachtet werden muss.“ (Kliemstein 1960)
Diese mitschwingende Begeisterung, in einer für Kliemstein so bezeichnenden über- schwänglichen Form zum Ausdruck gebracht, spricht für das intensive Nahverhältnis des heute schon legendären Galeristen zu seinen betreuten Künstlern. Im Falle Häupl-Kliemstein lag auch eine menschliche Gesinnungsverwandtschaft vor: beruhend auf Lauterkeit und unbezweifelbaren Echtheitsanspruch. Das Ergebnis war ein Erfolg dieser Erstausstellung bei Publikum und Presse und damit ein aufgestoßenes Tor zur Öffentlichkeit für den überbescheidenen, sich selbst versteckenden Künstler. Das Leben hat ihn allerdings nicht verwöhnt und ihn spartanisch zur Ausdauer, Beharrlichkeit und Genügsamkeit erzogen. Geboren am 6. Jänner 1926 in Pram nahe dem Innviertel wurde er schon von früh auf in eine Landschaft gepflanzt, die ihn in urwüchsiger Lebensfreude und Sinnierlust – bei ihm allerdings schweigsam nach innen gekehrt – aufwachsen ließ. Man spürt die, wenn auch andersgeartete, Erdnähe zu Billinger und Kubin in manchen seiner ganz klobig gebauten malerischen Frühwerke.
Er erlernte den Schlosserberuf, war in dieser handwerklichen Sparte nach Kriegseinsatz und englischer Gefangenschaft längere Zeit tätig – und – entdeckte im Alleingang seine Berufung (für ihn übersetzt: (Hingabefähigkeit) zur bildenden Kunst, zur Malerei, zum Vexierspiel mit der Farbe. Man kann seine Entscheidung, die Freizeit für aktive Betätigung in der Kunst zu opfern, als idealistisch einschätzen, aber in der Motivation und deren Bewegkraft ist sie doch als ein Entschluss zur Selbstverwirklichung zu werten. Seine Trag- und Belastungsfähigkeit im Brotberuf und als Familienvater war in seinem zähen Willen einbezogen. Mit dem Besuch der Kunstschule der Stadt Linz, zunächst in Abendkursen, später als Hörer und Schüler von Prof. Herbert Dimmel, gewann er die Möglichkeit, sich das handwerkliche Rüstzeug anzueignen. Die künstlerische Beeinflussung durch den Lehrer hielt sich in Grenzen, obwohl der kompakte malerische und kompositionstechnische Kanon des Malers Dimmel über den Lehrer Dimmel sich seinen Schülern wirkungsvoll aufdrängte. Er wirkte nicht so sehr schulbildend, als vielmehr stimulant prägend auf Häupl, dessen damalige Sehnsucht nach großen Vorbildern zwischen einem Cezanne und der kurzen fauvistischen Periode eines Georg Braque hin und her schwebte. Später war der kubistische Braque sein „Inbild“ einer absoluten Malerei. Der höhere Anspruch für das eigene Schaffen war also gegeben, der sensitive Anreiz wirksam, die Erlebniszone für die gestaltende Phantasie greifbar nahe abgesteckt. Landschaften Tiere, Stilleben, die Welt der kleinen Dinge boten sich an. Mit dem beruflichen Wechsel als Folge eines neuen Angebotes schien sich der Schwerpunkt Malerei auch lebensrealistisch zu festigen: Er kam in eine wichtige technische Abteilung des Linzer Landestheaters – als Maler, ein dem Bühnenbild verpflichteter Theatermaler! Er wurde Vorstand des Malersaales und innerlich „mitschwingend“ – und vom Bühnenzauber auch hinter den Kulissen berührt – ein besessener Theatermensch!
Durch seine Geschicklichkeit im Disponieren der wichtigen bühnenbildnerischen Vorarbeiten, seinem enormen Fleiß und das verständige Mitgehen mit den Ideen der Bühnenbildner wurde er zu einem nicht mehr wegzudenkenden Mitglied des Theaterensembles.
Aber erschlug nicht der nachproduzierende Theatermaler im Engagement den gestaltenden Maler im freien Schaffensprozess? Die impetuouse Handschrift, und damit die starke, wenn auch unausgegorene Bewältigung der Fläche, durch die für Häupls frühere Ölbilder so charakteristischen dunkeltönenden Farbballungen, lösten eine mehr in die Breite gezogene malerische Erzählweise ab. Die vollzog sich allerdings in einem mehr vordergründigen Duktus. Die Landschaften weisen, bei allen sensiblen linearen Verästelungen, einen, zwar noch immer einen dunkel eingetrübten, dekorativen Flächenglanz auf, der an die vereinfachten Abbreviaturen der französischen Fauvisten erinnert, sind aber in der Wirkung deutlich abgeschwächt. Immer stärker entfaltete sich dagegen der Graphiker Häupl. Man kann seine Lithographien als Höhepunkt seines Schaffens ansehen. Entscheidend für diesen Schwerpunktwechsel war vielleicht der Besuch der Salzburger Sommerakademie. Originalität der Einfälle paart sich hier mit klarem, formalem Aufbau und einer beachtlichen technischen Fertigkeit. Die Persönlichkeit des Lehrers Prof. Slavi Soucek war für Häupl ein starker Faktor für die sichere Beherrschung der handwerklichen Technik zur Umsetzung des graphischen Materials in eine immer ausgeprägter werdende künstlerische Eigensprache.
In seinen Farblithos, Holzschnitten und Aquarellen macht sich oft eine merkwürdige Mischung von Humor, kauziger Grübelei und hintergründiger Melancholie bemerkbar. Die Symbolkraft seiner Motive wirkt überzeugend auf die Vorstellungsphantasie des Beschauers ein und trug viel zum Erfolg in Ausstellungen bei (etwa in der Galerie Forum 67, in der Galerie der Hypothekenanstalt in Linz, Galerie St. Erhardt, Salzburg, Grüne Galerie, Klagenfurt, Galerie der Staatsdruckerei Wien, Galerie der Universität Innsbruck, Galerie Malkiste Berlin, …). Diese immer stärker betonte eigenschöpferische Alternative zum Bühnenmaler unterstrich immer mehr die vielseitige Gesamtpersönlichkeit Josef Häupls. Dazu kam auch der vielfach geglückte Sprung vom Bühnenmaler zum Bühnenbildner (u.a. im Linzer Landestheater, Linzer Kellertheater und Studiobühne Linz). Der dienstfreudige Geist Häupls am Werk bewies auch hier seine Umsetzungsfähigkeit. Nach all den aktiven Jahren unterbrach eine Krankheit den spannenden und angespannten Rhythmus. Der Künstler zog sich in seine einsame private Sphäre zurück. Von seinem Lebensauftrag galt es noch die letzte Klärung, Vereinfachung und Verdichtung zu vollziehen. Zurückgezogen, in seinem Garten pflegend sich seinen Blumen widmend, in seinem Atelier zur alleinigen Aussprache mit seiner geliebten Kunst bereit, schuf Häupl ein schmales, und doch gewichtiges, ganz zu sich selbst findendes Spätwerk. Objekte und Motive sind die gleichen geblieben: Landschaften, Häuser (bescheiden in die schlichte Bildumwelt und scheinbar am Rande eingebaut), Tiere und immer wieder Blumen. Eine bukolische Welt tat sich für ihn auf. Aus dem früheren expressiv angehauchten und teilweise konstruktiv durchdachten Bildwerk wurde ein idyllisch empfundenes, aus der Impression empfangenes Dekorium. Ein Holzschnittzyklus erinnert noch in etwa an frühere herb aufgebrochene Bildstrukturen, die kleinformatigen Ölbilder und vor allem die Aquarelle dokumentieren einen ergreifend schönen lyrischen Bild-Epilog eines reichhaltigen Schaffens, dessen große, stille Flamme im hohen Sommer erlosch
In Dankbarkeit für eine kreative Mitarbeit in Galerie und Theater –
Wilhelm Koller
(Galerist, Literat, Theaterregisseur)